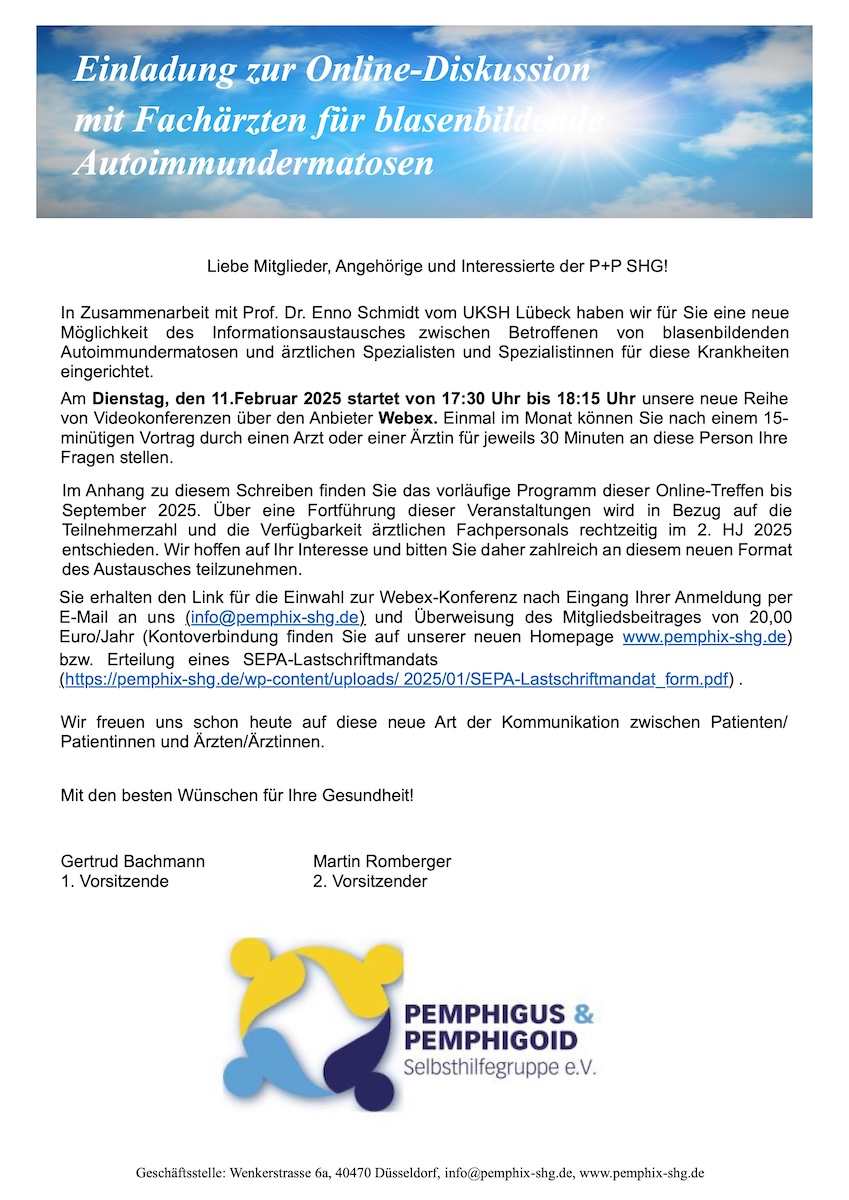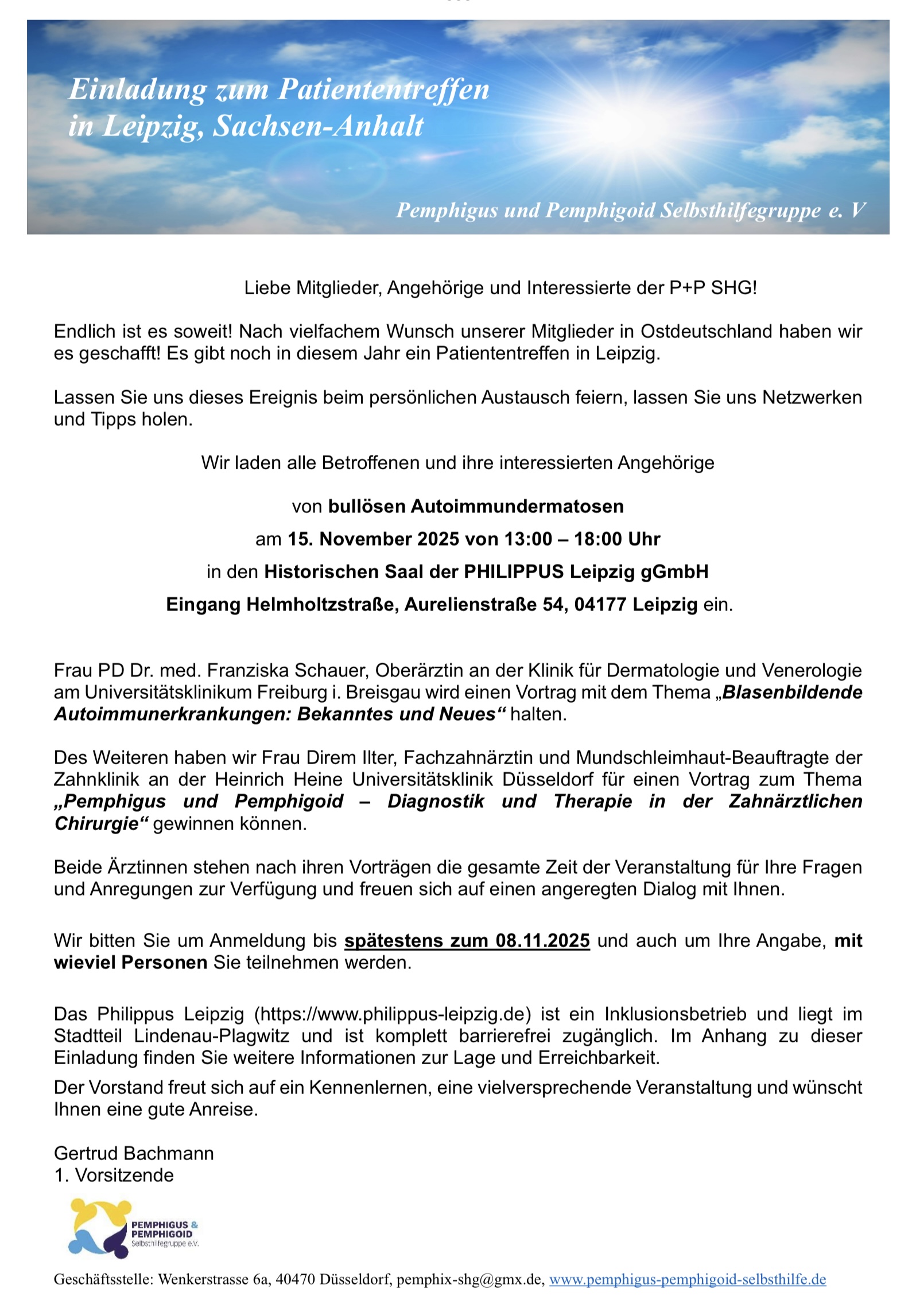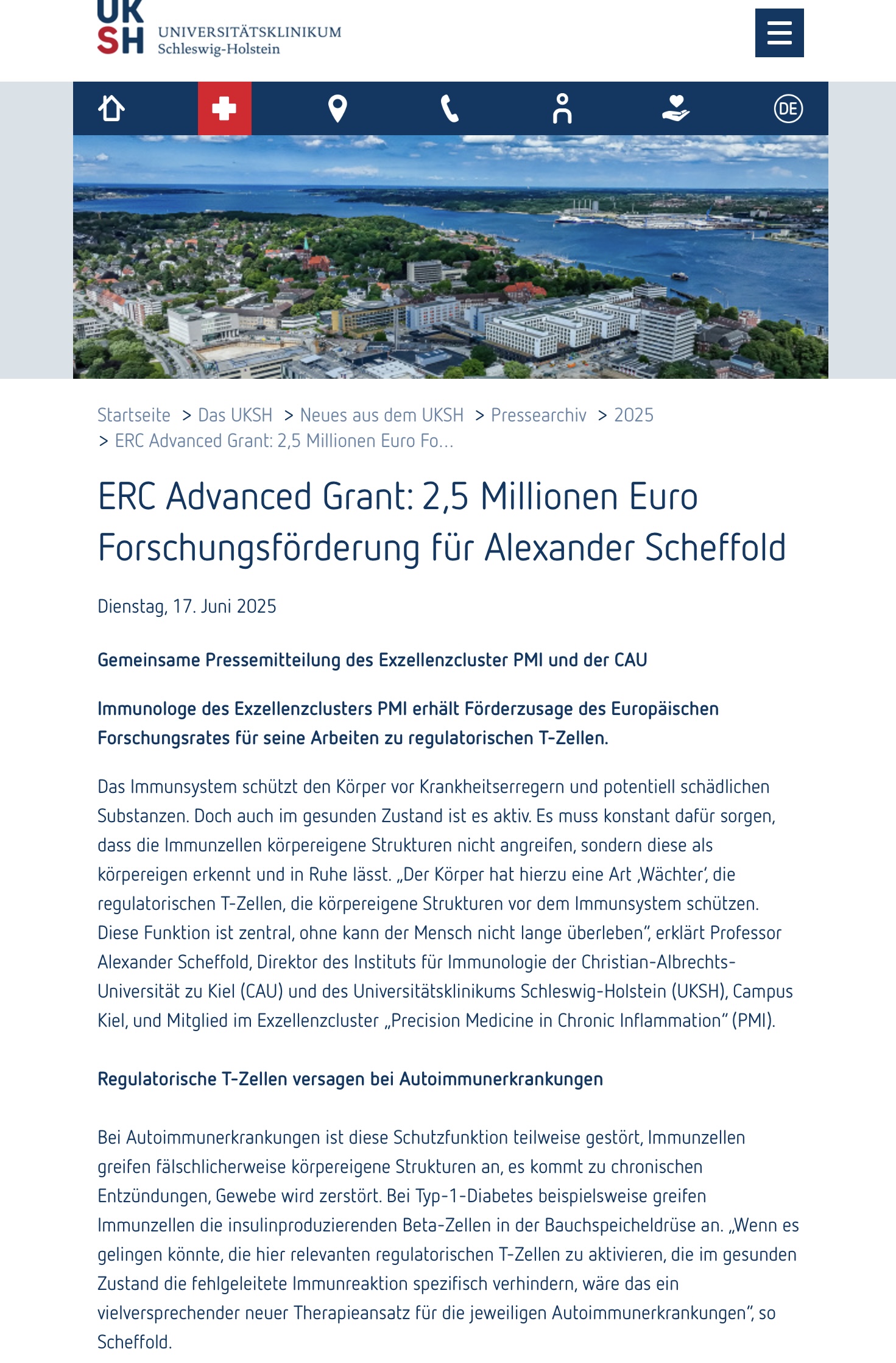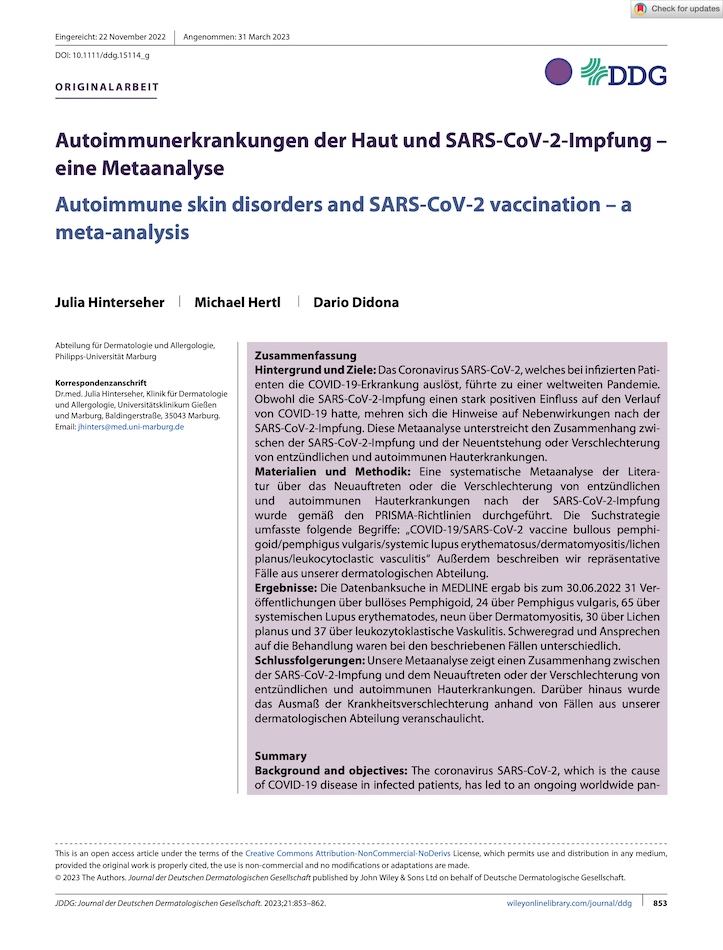Sie brauchen Informationen?
Sie suchen Erfahrungsaustausch?
Sie wollen nicht alleine mit Ihrer Erkrankung dastehen?
Unsere Selbsthilfegruppe bietet Ihnen:
- Ein telefonisches Erstgespräch mit Grundinformationen zu den verschiedenen Krankheitsbildern
- Ein Online-Forum mit der Möglichkeit des Austauschs untereinander
- Eine Webseite mit den neusten Informationen zu Diagnose, Therapie und Forschung
- Mitgliedertreffen in verschiedenen Bundesländern, z.T. mit ärztlichen Fachvorträgen
Aktuelles
Archiv
Your Subtitle Goes Here

—–
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 23.02.2025 in Kassel, Hessen
—–
Zusammenfassung des Patiententreffens am 24.11.2024 in Kassel, Hessen
—–
Einladung zum Patiententreffen am 24.11.2024 in Kassel, Hessen
—–
Zusammenfassung des Patiententreffens am 22.06.2024 in Gilching bei München, Bayern
—–
Einladung zum Patiententreffen am 22.06.2024 in Gilching bei München, Bayern
—–
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 25.02.2024 in Kassel, Hessen
—–
Einladung zum Patiententreffen am 11.11.2023 in Stuttgart, Baden-Württemberg
—–
Zusammenfassung des Patiententreffens am 07.10.2023 in Köln
Krankheitsbilder, Diagnostik und Therapien
Pemphigus
Your Subtitle Goes Here

Was versteht man unter Pemphigus?
Der Pemphigus (griech. pemphix = Blase) ist eine seltene, schwere und meist chronisch verlaufende Erkrankung der Haut und der Schleimhäute mit Blasenbildung. Es werden zwei Hauptformen unterschieden, der Pemphigus vulgaris und der Pemphigus foliaceus. Während beim Pemphigus vulgaris die Schleimhäute (fast immer die Mundschleimhaut) befallen sind und es zusätzlich zu Blasen/Erosionen am Körper kommen kann, ist beim Pemphigus foliaceus ausschließlich die Körperhaut betroffen. Charakteristischerweise entstehen die Blasen sehr oberflächlich in der Haut, innerhalb der Oberhaut (Epidermis). Die Blasen sind meist schlaff und mit klarer Flüssigkeit gefüllt. Durch rasches Aufplatzen des dünnen Blasendaches kommt es zu häufig großflächigen, schmerzhaften, nässenden oder krustig belegten Hautdefekten (Erosionen). Diese heilen langsam, in der Regel ohne Narbenbildung ab. Früher, vor 1950, war der Pemphigus vulgaris eine lebensbedrohliche Erkrankung, heute stehen jedoch verschiedene wirkungsvolle Medikamente (u.a. Kortison) zur Verfügung, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Wann und wie häufig tritt der Pemphigus auf?
Der Pemphigus ist mit 0,1 bis 0,5 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner im Jahr eine seltene Erkrankung und tritt bei beiden Geschlechtern etwa gleich häufig auf, typischerweise zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr.
Was ist die Ursache des Pemphigus und was geschieht in der Haut?
Beim Pemphigus vulgaris und Pemphigus foliaceus werden bestimmte Eiweißstoffe, sog. Autoantikörper gebildet, die sich gegen spezifische körpereigene Strukturen der Haut (Autoantigene) richten: Desmogleine. Desmogleine sind die „Kittsubstanz“ zwischen den Hautzellen und die Bildung von Autoantikörpern führt zur Zerstörung dieser Kontaktstellen. Dies führt zur Spaltbildung innerhalb der Oberhaut, die sich mit Gewebsflüssigkeit füllt. Das Autoantigen des Pemphigus vulgaris ist Desmoglein 3, beim Pemphigus foliaceus ist es Desmoglein 1. Bei Patienten mit Pemphigus vulgaris, die an Haut- und Schleimhautveränderungen leiden, wird zusätzlich zu Desmoglein 3 auch Desmoglein 1 erkannt. Desmogleine sind wichtige Proteine, die den Zusammenhalt der Zellen in der Oberhaut vermitteln. Die genaue Ursache, warum es zur Ausbildung von Autoantikörpern kommt, ist noch nicht geklärt. Unter anderem können verschiedene Medikamente an der Auslösung eines Pemphigus beteiligt sein. Betroffen sind insbesondere Hautareale, die stärkeren Druck- bzw. Reibebelastungen ausgesetzt sind (Rücken, Gesäß) sowie die Schleimhäute von Mund, Nase, Rachen oder Genitale. Sehr selten können die Bindehäute des Auges beteiligt sein.
Wie verläuft der Pemphigus?
Die Ausprägung und Schwere der Hautveränderungen variiert von Patient zu Patient. Das klinische Erscheinungsbild wird bestimmt von der Lokalisation der Spaltbildung innerhalb der Zellschichten der Oberhaut. Diese ist abhängig davon, welches Autoantigen der Zellkontaktstellen angegriffen wird. Häufig sind Patienten mit Pemphigus vulgaris vor allem durch die sehr schmerzhaften Veränderungen an der Mundschleimhaut stark beeinträchtigt. Nicht selten kommt es aufgrund der schmerzhaften Nahrungsaufnahme zur deutlichen Gewichtsabnahme und allgemeiner Schwäche.
Wie kann der Pemphigus diagnostiziert werden?
Erste Hinweise für die Diagnose ergeben sich aus dem klinischen Erscheinungsbild. So lassen sich Blasen durch Schiebedruck auf gesunder Haut auslösen (sog. Nikolski-Phänomen). Diagnostische Tests zum Nachweis der Autoantikörper in der Haut/Schleimhaut sowie im Blut stehen heute zur genauen Analyse zur Verfügung.
- Entscheidend für die Diagnose ist die mikroskopische Untersuchung einer Gewebeprobe. In Spezialfärbetechniken (direkte Immunfluoreszenz) werden die Haftstellen der Autoantikörper sichtbar gemacht.
- Die krankheitsspezifischen Autoantikörper sind bei fast allen Patienten auch im Blut nachweisbar und es besteht eine direkte Beziehung zwischen der Menge der Antikörper und der Schwere des Krankheitsverlaufes. Die Autoantikörper im Blut der Pemphiguspatienten lassen sich mittels Spezialuntersuchungen (indirekte Immunfluoreszenztechnik, ELISA) im Labor nachweisen.
Wie wird der Pemphigus behandelt?
Je nach Schwere der Erkrankung werden äußerliche und innerliche Therapiemaßnahmen kombiniert. In der Regel erfolgt die Einleitung der Therapie im Rahmen eines stationären Aufenthaltes. Ziel der Behandlung ist die Unterdrückung der Bildung von Autoantikörpern gegen körpereigene Strukturen bzw. die Verhinderung der Entzündungsreaktion, die durch die Bindung der Autoantikörper in der Oberhaut ausgelöst wird. Sollte ein auslösendes Medikament in Erwägung gezogen werden, sollte dieses zügig ab- oder auf ein anderes Präparat umgesetzt werden. Dies sollte immer nach Rücksprache mit dem verschreibenden (Haus-) Arzt erfolgen.
* Innerlich anzuwendende Medikamente: Es stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung: In der Akutphase werden Kortisonpräparate eingesetzt, dabei wird die Dosierung der Schwere der Erkrankung angepasst. Mittel- und langfristig werden weitere Arzneistoffe kombiniert oder einzeln eingesetzt, um möglichst bald die Dosierung von Kortison reduzieren zu können, wie Azathioprin oder Mycophenole (Mycophenolatmofetil, Mycophenolat-Natrium). In schwersten Fällen der Erkrankung mit einer äußerst hohen Konzentration von Antikörpern im Blut kann eine spezielle „Blutwäsche“ (Immunadsorption) oder die intravenöse Gabe hoch-dosierter menschlicher Antikörper (Immunglobuline) hilfreich sein.
2019 wurde derAnti-CD20 Antikörper Rituximab zur Behandlung des mittelschweren/moderaten und schweren Pemphigus vulgaris zugelassen. Seitdem kann Rituximab bei diesen Patienten auch als erste Therapie eingesetzt werden in Kombination mit oralen oder intravenösen Kortisonpräparaten.
* Äußerlich anzuwendende Präparate: Zur Entzündungshemmung und zur lokalen Unterdrückung der Antikörperbildung kommen kurzfristig Kortisonpräparate in verschiedener Stärke und in jeweils für die Lokalisation geeigneten Grundlagen (Cremes, Lotionen, Spülungen, Pasten) zur Anwendung. Begleitinfektionen durch Bakterien und/oder Pilze kann durch eine spezifische Therapie vorgebeugt werden.
Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Die Erkrankung tritt spontan auf und verläuft im Allgemeinen über viele Monate und Jahre in „Schüben“. Durch die modernen Behandlungsverfahren kann in etwa 80% der Fälle eine langfristige Erscheinungsfreiheit erreicht werden.
Pemphigoid
Your Subtitle Goes Here

Übersicht
Was versteht man unter einem bullösen Pemphigoid?
Das bullöse Pemphigoid (lat. bullosa: blasig und griech. pemphix: Blase) gehört zur Gruppe der chronisch verlaufenden Blasen bildenden Erkrankungen der Haut. Die Erkrankung kommt typischerweise bei älteren Patienten vor. Charakteristisch ist das Auftreten von prallen Blasen auf entzündlich geröteter oder normaler Haut sowie ausgeprägter Juckreiz. Die Blasen treten am gesamten Körper auf, die Schleimhäute sind nur in etwa 20% betroffen.
Wie häufig tritt das bullöse Pemphigoid auf?
Das bullöse Pemphigoid ist mit ca. 2 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner/Jahr eine seltene Erkrankung. Innerhalb der Blasen bildenden Autoimmundermatosen ist das bullöse Pemphigoid jedoch mit Abstand die häufigste Erkrankung und die Erkrankungswahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter deutlich an: bei über 90-Jährigen beträgt sie fast 40 Patienten pro 100.000 Einwohner/Jahr.
Was sind die Auslöser für das Auftreten eines bullösen Pemphigoids?
Die Ursachen für das Auftreten dieser Autoimmunerkrankung der Haut sind nicht vollständig geklärt.
Was geschieht in der Haut?
Beim bullösen Pemphigoid richtet sich das eigene Immunsystem gegen Bestandteile der Haut. Es kommt zur Blasenbildung durch Bildung von speziellen Eiweißstoffen, sog. Autoantikörpern, die gegen diese Bestandteile der Haut gerichtet sind. Angriffspunkte für die Autoantikörper sind zwei Proteine am Übergang der Oberhaut (Epidermis) zur Lederhaut (Dermis). Diese Proteine sind die sog. bullösen Pemphigoid-Antigene BP180 und BP230.
Wie verläuft das bullöse Pemphigoid?
Die Ausdehnung der Hautveränderungen und somit die Schwere der Erkrankung sind von Patient zu Patient unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Allgemeinbefinden ist durch den intensiven Juckreiz häufig stark beeinträchtigt. lm Verlauf können infolge wiederkehrender Blasenschübe u. a. Appetitverlust, Gewichtsabnahme, allgemeine Schwäche und Fieber auftreten.
Wie kann das bullöse Pemphigoid diagnostiziert werden?
Das klinische Bild und das in der Regel hohe Alter der Patienten geben erste Hinweise auf die Erkrankung. Zur genauen Diagnosestellung bedarf es zusätzlich einer Gewebeprobe und einer Blutentnahme.
Durch eine spezielle Färbetechnik lassen sich die Autoantikörper in einer Gewebeprobe der Haut nachweisen: hier zeigen sich lineare Ablagerungen von Antikörpern entlang der Grenzfläche zwischen Oberhaut (Epidermis) und Lederhaut (Dermis).
Die Autoantikörper lassen sich bei fast allen Patienten im Blut nachweisen. Hierzu werden verschiedene Spezialtechniken verwendet (indirekte Immunfluoreszenz auf Spalthaut, ELISA). Hier können die charakteristischen Antikörper gegen BP180 und BP230 nachgewiesen werden. Besondere Bedeutung kommt dem Nachweis von Antikörpern gegen BP180 zu, da die Menge der Antikörper in direktem Verhältnis mit der Zahl und Ausdehnung der Blasen/ Erosionen steht.
Wie wird das bullöse Pemphigoid behandelt?
Je nach Schwere der Erkrankung werden äußerliche und innerliche Therapiemaßnahmen kombiniert. In der Regel erfolgt die Einleitung der Therapie im Rahmen eines stationären Aufenthaltes. Ziel der Behandlung ist die Unterdrückung der Bildung von Autoantikörpern.
- Innerlich anzuwendende Medikamente: Es stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung: In der Akutphase werden Kortisonpräparate eingesetzt. Die Dosierung wird der Schwere der Erkrankung angepasst. Mittel- und langfristig werden weitere Arzneistoffe kombiniert oder einzeln eingesetzt: z. B. Dapson oder Doxyzyklin oder auch Azathioprin, Mycophenole (Mycophenolatmofetil, Mycophenolat-Natrium) und Methotrexat. Diese Medikamente sollen einen kortisonsparenden Effekt ausüben und so die Nebenwirkungen reduzieren.
- Äußerlich anzuwendende Präparate: Zur äußerlichen Behandlung werden nach Punktion von großen prallen Blasen desinfizierende Lösungen sowie kortisonhaltige Cremes angewendet.
- In vielen Fällen ist die großflächige Behandlung mit kortisonhaltigen Cremes ggf. in Kombination mit Tabletten ausreichend.
Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Die Erkrankung tritt spontan auf und verläuft im Allgemeinen schubweise über viele Monate bzw. Jahre. In zwei Drittel der Patienten heilt die Erkrankung nach einigen Jahren aus, so dass keine Behandlung mehr erforderlich ist. Mit den modernen Behandlungsverfahren kann jedoch auch in allen anderen Fällen eine langfristige Erscheinungsfreiheit erreicht werden.
Was versteht man unter einem Schleimhautpemphigoid?
Das Schleimhautpemphigoid (griechisch: pemphix: Blase) gehört zu den chronisch verlaufenden Blasen bildenden Autoimmunerkrankungen. Charakteristisch und namengebend für diese Erkrankungen ist die überwiegende Beteiligung der Schleimhaut. Zusätzlich können Blasen und oberflächliche Hautwunden (Erosionen) auch am Körper auftreten, diese können mit Narbenbildung abheilen.
Früher wurde für diese Erkrankung der Begriff „vernarbendes Pemphigoid“ verwendet. Er gilt heute nur noch für die sehr seltene Form bei Patienten, die keine überwiegende Schleimhautbeteiligung haben und bei denen die Blasen/Erosionen am Körper mit Narbenbildung abheilen.
Wie häufig tritt das Schleimhautpemphigoid auf?
Das Schleimhautpemphigoid ist mit ca. 2 Neuerkrankungen auf 1 Mio. Einwohner/Jahr eine seltene Erkrankung.
Auslöser für das Auftreten eines Schleimhautpemphigoids
Die Ursachen für das Auftreten dieser Autoimmunerkrankung sind nicht geklärt. Bisher gibt es keine Hinweise für Medikamente oder Nahrungsmittel als Auslöser der Erkrankung.
Was geschieht in der Schleimhaut?
Beim Schleimhautpemphigoid richtet sich das eigene Immunsystem gegen Bestandteile der Haut und es kommt zur Bildung von speziellen Eiweißstoffen, sogenannten Autoantikörpern. Angriffspunkte für die Autoantikörper sind mehrere Proteine innerhalb der Basalmembran, der Verbindungsschicht zwischen Oberhaut (Epidermis) und Lederhaut (Dermis). Zu den Proteinen, die von den Autoantikörpern gebunden werden (den sogenannten Zielantigenen) gehören: BP180, BP230, Laminin 332 (früher auch Laminin 5 oder Epiligrin genannt) und α6β4-Integrin. 25 % der Patienten mit Antikörpern gegen Laminin 332 entwickeln im Verlauf eine Krebserkrankung. Daher ist die genaue Diagnostik der Autoantikörper von großer Bedeutung, um ggf. durch eine anschließende Tumorsuche eine Begleiterkrankung frühzeitig zu erkennen.
Wie verläuft das Schleimhautpemphigoid?
Die Ausdehnung der Hautveränderungen und somit die Schwere der Erkrankung sind von Patient zu Patient unterschiedlich stark ausgeprägt. Durch die häufig schmerzhaften Mundschleimhautveränderungen kommt es häufig zu Schwierigkeiten beim Essen und in Folge zur Gewichtsabnahme und allgemeinen Schwäche.
Bei den meisten Patienten beginnt die Erkrankung in der Mundschleimhaut, dies ist auch häufig die am schwersten betroffene Schleimhautregion. Bei einigen Patienten kann die Erkrankung jedoch in der Nasenschleimhaut beginnen, was sich durch Nasenbluten, Ausbildung von blutigen Krusten sowie verringerter Nasenatmung äußern kann. Bei einigen Patienten, vor allen Dingen Frauen, ist die Genitalschleimhaut am stärksten betroffen.
Als weitere Schleimhäute können der Rachen, die Speiseröhre und die Schleimhaut am After betroffen sein. In den Schleimhäuten zerreißen Blasen leicht und es kommt zur Ausbildung von meist schmerzhaften Wunden (Erosionen).
Auch die Bindehäute der Augen können betroffen sein, was zu einer Narbenbildung und im schlimmsten Fall bis zur Erblindung führen kann. Patienten mit Beteiligung der Bindehaut bedürfen daher ganz besonders dringend einer intensiven Therapie. Unter einem okulären Pemphigoid versteht man ein Schleimhautpemphigoid mit ausschließlicher Beteiligung der Bindehäute der Augen.
Wie kann das Schleimhautpemphigoid diagnostiziert werden?
Das klinische Bild mit Erosionen der Mund- oder Genitalschleimhaut sowie beim okulären Pemphigoid der Bindehaut des Auges ergibt erste Hinweise auf diese Erkrankung. Für die genaue Diagnosestellung sind eine Gewebeprobe und eine Blutentnahme notwendig.
- Durch eine spezielle Färbetechnik lassen sich die Autoantikörper in einer Gewebeprobe der Schleimhaut nachweisen. Diese Schleimhautprobe kann an unbefallener Wangenschleimhaut entnommen werden. Typischerweise zeigen sich lineare Ablagerungen von Antikörpern entlang der Grenzfläche zwischen Schleimhaut und darunter liegender Verbindungsschicht.
- Die Autoantikörper lassen sich bei manchen Patienten auch im Blut nachweisen. Hierzu werden Spezialuntersuchungen durchgeführt (indirekte Immunfluoreszenz auf Spalthaut, ELISA, Westernblot).
Wie wird das Schleimhautpemphigoid behandelt?
Bei der Behandlung des Schleimhautpemphigoids muss zwischen Patienten ohne Beteiligung der Bindehäute und Patienten mit Beteiligung der Bindehäute der Augen unterschieden werden. In der Regel erfolgt die Einleitung der Therapie im Rahmen eines stationären Aufenthaltes. Ziel der Behandlung ist die Unterdrückung der Bildung der Autoantikörper sowie der Entzündung der Schleimhäute.
Schleimhautpemphigoid ohne Beteiligung der Bindehäute
Es stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. In der Akutphase werden Kortisonpräparate eingesetzt, die mit weiteren Medikamenten, wie z. B. Dapson, Azathioprin, Mycophenolatmofetil, Mycophenolat-Natrium oder Cyclophosphamid kombiniert werden können. Diese Medikamente sollen einen Kortisonsparenden Effekt ausüben und entsprechende Nebenwirkungen verringern.
In sehr schweren Fällen oder bei unzureichendem Ansprechen auf die oben genannten Medikamente kann bei hohen Konzentrationen von Antikörpern im Blut eine spezielle „Blutwäsche“ (Immunadsorption) durchgeführt werden. Zudem können Infusionen mit hoch-dosierten menschlichen Antikörpern (Immunglobuline) zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren wurde zudem über die erfolgreiche Behandlung mit dem Medikament „Rituximab“ berichtet.
Patienten mit Bindehautbeteiligung
Bei diesen Patienten droht eine Vernarbung der Bindehäute, die mit einer bleibenden Sehschädigung oder sogar Erblindung einhergehen kann. Deswegen ist hier in der Regel eine sehr schnelle und intensive Therapie notwendig, die das überreagierende Immunsystem unterdrücken soll. Neben Kortikosteroiden (Kortison) wird hier häufig Cyclophosphamid eingesetzt.
Patienten mit Antikörper gegen Laminin 332
Da bei bis zu 25 % dieser Patienten eine Krebserkrankung vorliegen kann, sollte vor Einleitung einer Therapie eine gründliche Durchuntersuchung erfolgen und ggf. frühzeitig mit einer Tumorbehandlung begonnen werden.
Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Die Erkrankung tritt spontan auf und verläuft in der Regel schubweise über viele Monate/Jahre. Durch die heute möglichen modernen Behandlungsverfahren kann in der Mehrheit der Patienten eine langfristige Erscheinungsfreiheit erreicht werden.
Bei Beteiligung der Bindehäute der Augen ist eine zügige Kooperation mit Augenärzten unerlässlich. Aufgrund einer möglichen Beteiligung des Rachens ist eine enge Kooperation mit Hals-Nasen-Ohrenärzten notwendig, bei anderen Schleimhautbeteiligungen auch eine Vorstellung in den entsprechenden Fachdisziplinen (Gastroenterologen, Gynäkologen, Urologen, Proktologen).
Diagnostik
Your Subtitle Goes Here

Die exakte Diagnose der Blasen bildenden Autoimmundermatosen ist von großer Bedeutung für die Prognose und die Therapieentscheidung.
Zur genauen Diagnosestellung bedarf es des Nachweises der krankheitsspezifischen Autoantikörper in der Haut/Schleimhaut sowie im Blut. Hierzu sind mindestens eine Gewebeprobe sowie eine Blutentnahme notwendig.
Nachweis der Autoantikörper in der Haut/Schleimhaut
Durch eine spezielle Färbetechnik lassen sich die Autoantikörper in dieser Hautprobe nachweisen. Hierdurch können die Pemphigus-Erkrankungen von den Pemphigoid-Erkrankungen unterschieden werden. Bei den Pemphigus-Erkrankungen binden die Autoantikörper ausschließlich in der Oberhaut (Epidermis) und zeigen ein netzförmiges Muster. Bei den Pemphigoid-Erkrankungen binden diese dagegen entlang der Basalmembran, der Grenzfläche zwischen Oberhaut (Epidermis) und Lederhaut (Dermis) und zeigen ein sog. lineares Muster.
Nachweis der Autoantikörper im Blut
Hierzu stehen Suchtests (Screening-Tests) und spezifische Testsysteme zur Verfügung.
Screening-Tests
Als Screening-Test für Pemphigus-Erkrankungen ist die „indirekte Immunfluoreszenz“-Untersuchung auf Gewebeschnitten von Affen- oder Meerschweinchenspeiseröhre geeignet. Diese Gewebe weisen eine besonders hohe Dichte von Haftstrukturen auf, die von den Autoantikörpern erkannt werden.
Bei den Pemphigoid-Erkrankungen wird zusätzlich menschliche „Spalthaut“ verwendet. Spalthaut wird durch das Einlegen gesunder Haut („überschüssiges“ Gewebe im Rahmen von Operationen, das sonst verworfen würde) in eine hochprozentige Kochsalzlösung hergestellt.
Das Blut des zu untersuchenden Patienten wird dann mit den jeweiligen Gewebeschnitten (Affen-, Meerschweinchenösophagus, Spalthaut) zusammengebracht, so dass die Autoantikörper im Blut an die Gewebeschnitte binden können und in einer speziellen Färbetechnik am Mikroskop nachgewiesen werden.
Spezifische Testverfahren
Bei nachgewiesener Reaktivität in den Screening-Tests kann die genaue Zielstruktur der Autoantikörper, das sogenannte Autoantigen, mit Hilfe spezieller Untersuchungstechniken, sogenannter ELISA-, Immunfluoreszenz- oder Westernblot Untersuchungen identifiziert werden. Für die Untersuchung der folgenden Autoantigene stehen spezifische Testsysteme zur Verfügung:
- Desmoglein 1
- Desmoglein 3
- Envoplakin
- Periplakin
- Desmoplakin
- BP 180
- BP 230
- Laminin 332
- p200-Protein/ Laminin β4/ Laminin γ1
- Typ VII Kollagen
Die Identifizierung des Zielantigens der Autoantikörper sollte immer angestrebt werden, da hierüber wichtige Informationen zur Prognose und Therapie der Erkrankungen verfügbar werden.
So liegt z.B. bei einem Viertel der Patienten mit Autoantikörper gegen Laminin 332 eine Krebserkrankung vor, die durch diese Erkenntnisse heute frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden kann. Patienten mit Antikörpern gegen das -p200 Protein/ Laminin β4 sind z.B. relativ gut zu behandeln, während Patienten mit Antikörpern gegen Typ VII Kollagen bei der Epidermolysis bullosa acquisita in aller Regel einer intensiveren Therapie bedürfen.
Therapie
Your Subtitle Goes Here

Da es sich bei den Blasen bildenden Autoimmundermatosen um seltene Erkrankungen handelt, liegen weltweit nur wenige Therapiestudien vor. Auch sind derzeit in Deutschland keine festgelegten Therapieleitlinien verfügbar.
In der Regel werden Glukokortikosteroide (sogenannte Kortisonpräparate) in Kombination mit Kortikosteroid-sparenden Medikamenten (sog. Immunsuppressiva/ Immunmodulatoren) eingesetzt, die die krankmachende Körperabwehr dämpfen oder regulieren sollen. Man unterscheidet zudem „First line“-Therapien, also Therapien, die aufgrund der bekannten Wirksamkeit zuerst zur Behandlung eingesetzt werden, von „Second line“-Therapien, die erst nach erfolglosem Einsatz einer „First line“-Therapie Verwendung finden.
First line-Therapien
Glukokortikosteroide (Kortisonpräparate)
Hier werden meist Prednisolon oder Methylprednisolon in Tablettenform gegeben. Die Anfangsdosis richtet sich nach dem Körpergewicht sowie nach der einzelnen Erkrankung. So wird beim Pemphigus häufig mit einer Prednisolondosis von 1 mg/kg Körpergewicht/Tag begonnen, während beim bullösen Pemphigoid eine niedrigere Prednisolondosis von 0,5 mg/kg Körpergewicht/Tag eingesetzt wird.
Bei einigen Erkrankungen (z. B. beim bullösen Pemphigoid, der linearen IgA-Dermatose, dem Pemphigoid gestationis und dem Anti-p200 Pemphigoid) kann häufig sogar auf eine Kortison-Therapie in Tablettenform verzichtet werden; es kommen dann stark wirksame Kortisonpräparate in Creme- oder Salbenform zum Einsatz.
Alternativ können Glukokortikosteroide anstelle von Kortisontabletten auch als Infusion gegeben werden. So wird bei der „Dexamethason-Pulstherapie“ an drei aufeinander folgenden Tagen das Kortisonpräparat Dexamethason in die Vene infundiert. Diese Pulstherapie kann zunächst alle drei bis vier Wochen gegeben werden, dann können die Intervalle weiter gestreckt werden. Die Dexamethason-Pulstherapie kommt vor allem beim Pemphigus und beim Schleimhautpemphigoid zum Einsatz.
Um Nebenwirkungen der Kortisontherapie wie z.B. Magen-Darmgeschwüren vorzubeugen, werden meist sog. Protonenpumpenhemmer (z. B. Pantoprazol oder Omeprazol) eingesetzt, die die Magensäure reduzieren.
Zur Vorbeugung einer Osteoporose werden Kalzium (1.000 mg/Tag) und Vitamin D3 (1.000 I.E.) gegeben. Es ist sinnvoll, vor und unter längerfristiger Kortisonbehandlung alle 2 Jahre eine Knochendichtemessung durchführen zu lassen, damit eine (vor)bestehende Osteoporose frühzeitig diagnostiziert und ggf. behandelt werden kann.
Die Behandlung mit Kortisontabletten, Kortisoninfusionen oder Kortisoncremes ist in aller Regel über Wochen und meist sogar Monate notwendig. Es sollte immer versucht werden, diejenige Kortisonpräparation und -dosis einzusetzen, bei der die wenigsten Langzeitnebenwirkungen zu erwarten sind.
Immunmodulatoren
Immunmodulatoren werden in der Regel mit Kortisontabletten oder Kortison-haltigen Cremes/ Salben kombiniert, um die Gesamt-Kortionsdosis möglichst gering zu halten. Eingesetzt werden Dapson und bestimmt Antibiotika wie Doxyzyklin.
Immunsuppressiva
Um die Kortisondosis möglichst gering zu halten, werden zusätzlich Immunsuppressiva eingesetzt. Diese Medikamente unterdrücken verschiedene Komponenten des Immunsystems und können zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Zu diesen Präparaten zählen Azathioprin, Mycophenole (Mycophenolatmofetil, Mycophenolat-Natrium), Cyclophosphamid und Methotrexat.
Rituximab
Bei Rituximab handelt es sich um einen künstlich hergestellten Antikörper, der bestimmte Immunzellen, sogenannte CD20-positive B-Zellen, die für die Produktion der Autoantikörper verantwortlich sind, für einige Monate aus dem Blut entfernt. Rituximab wurde 2019 als First line-Therapie des mittelschweren/moderaten und schweren Pemphigus vulgaris zugelassen.
Rituximab wird als Infusion in die Vene gegeben und meist zweimal im Abstand von drei Wochen infundiert. Im Rahmen des Einsatzes von Rituximab bei Blasenbildenden Autoimmundermatosen wurde über eine erhöhte Rate an Infektionen berichtet.
Second line-Therapien
Second line-Therapien werden eingesetzt, wenn die First line-Therapie nicht ausreichend wirksam war. Die unten genannten Verfahren/ Medikamente können jedoch auch bei Patienten mit besonders ausgeprägten Erkrankungen als erste Therapie zum Einsatz kommen und werden in aller Regel mit Glukokortikosteroiden (Kortisonpräparaten und Immunmodulatoren/ Immunsuppressiva) kombiniert.
Rituximab
Rituximab wurde 2019 als First line-Therapie des mittelschweren/moderaten und schweren Pemphigus vulgaris zugelassen. Für alle andern Blasen bildenden Autoimmundermatosen besteht keine Zulassung. Es gibt jedoch langjährige Erfahrungen beim Pemphigus foliaceus, Schleimhautpemphigoid, Epidermolysis bullosa acquisita. Zudem wurde Rituximab auch bei Patienten mit bullösem Pemphigoid erfolgreich eingesetzt.
Hoch-dosierte intravenöse Immunglobuline
Intravenöse Immunglobuline (IVIG) werden als Infusion über die Vene verabreicht und stammen aus Blutbestandteilen von Blutspendern. Immunglobuline werden gewöhnlich über zwei bis fünf Tage in vierwöchigen Abständen gegeben.
Immunabsorption (Blutwäsche)
Bei der Immunabsorption handelt es sich um ein Blutwäscheverfahren, bei dem die krankheitsauslösenden Autoantikörper aus dem Blut entfernt werden. Die Immunadsorption wird in der Regel an drei bis vier aufeinander folgenden Tagen stationär in spezialisierten Universitätskliniken durchgeführt.
Wissenschaftlicher Beirat
Your Subtitle Goes Here

Der wissenschaftliche Beirat berät die “Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.”. Die in der verschiedenen Rubriken zusammengestellten Texte zu den einzelnen Erkrankungen sowie der Diagnostik und Therapie wurden vom wissenschaftlichen Beirat durchgesehen.
Externe Links:
Prof. Dr. Dr. med. Miklós Sárdy, Dermatologe – München, Budapest (Ungarn)
Prof. Dr. med. Michael Sticherling, Leitender Oberarzt, Universitäts-Hautklinik Erlangen
Mitgliedschaft
Post + Email
Your Subtitle Goes Here

Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.
Geschäftsstelle
Gertrud Bachmann
Wenkerstraße 6a
40470 Düsseldorf
Anfrage:
Telefon
Your Subtitle Goes Here

Telefonkontakt:
0162/5206728
(1. Vorsitzende – Gertrud Bachmann)
0162/5205656
(2. Vorsitzender – Martin Romberger)
Bankverbindung
Your Subtitle Goes Here

Bankverbindung:
Vereinigte VR Bank eG Föhr-Amrum-Kaltenkirchen
IBAN DE24 2179 1906 0000 3532 56
Warum Mitglied werden?
Your Subtitle Goes Here

Vorteile der Mitgliedschaft:
- Informationen und Einladungen zu Vereinsveranstaltungen per Mail-Verteiler
- Vereinsinterner Austausch über das Forum oder Kontaktaufnahme per Email und WhatsApp-Gruppe
In 2025 verzeichnen wir 400 Mitglieder!
Die Mitgliedschaft kann per Post
Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.
Geschäftsstelle
Gertrud Bachmann
Wenkerstraße 6a
40470 Düsseldorf
oder über info@pemphix-shg.de beantragt werden.
Der Jahresbeitrag beträgt 20 Euro.
Mitgliedsantrag & SEPA-Formular (PDF-Download)
Your Subtitle Goes Here

Mitgliedsantrag (online)
Your Subtitle Goes Here

Widerrufsformular (PDF-Download)
Your Subtitle Goes Here

Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also eine natürliche Person, welche die Beauftragung zu einem Zweck vornimmt, der überwiegend weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Sie haben in dem Fall das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V., Wenkerstraße 6a, 40470 Düsseldorf, E-Mail: info@pemphix-shg.de, Telefon: 0162/5206728 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten stehende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
(4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
![]() Widerrufsformular (PDF-Download)
Widerrufsformular (PDF-Download)
Post + Email
Your Subtitle Goes Here

Geschäftsstelle
Gertrud Bachmann
Wenkerstrasse 6a
40470 Düsseldorf
Anfrage:
Telefon
Your Subtitle Goes Here

Telefonkontakt:
0162/5206728
(1. Vorsitzende – Gertrud Bachmann)
0162/5205656
(2. Vorsitzender – Martin Romberger)
Bankverbindung
Your Subtitle Goes Here

Bankverbindung:
Vereinigte VR Bank eG Föhr-Amrum-Kaltenkirchen
IBAN DE24 2179 1906 0000 3532 56
Warum Mitglied werden?
Your Subtitle Goes Here

Vorteile der Mitgliedschaft:
- Informationen und Einladungen zu Vereinsveranstaltungen per Mail-Verteiler
- Vereinsinterner Austausch über das Forum oder Kontaktaufnahme per Email und WhatsApp-Gruppe
In 2025 verzeichnen wir 400 Mitglieder!
Die Mitgliedschaft kann per Post
Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.
Geschäftsstelle
Gertrud Bachmann
Wenkerstrasse 6a
40470 Düsseldorf
oder über info@pemphix-shg.de beantragt werden.
Der Jahresbeitrag beträgt 20 Euro.
Mitgliedsantrag & SEPA-Formular (PDF-Download)
Your Subtitle Goes Here

Mitgliedsantrag (online)
Your Subtitle Goes Here

Widerrufsformular (PDF-Download)
Your Subtitle Goes Here

Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also eine natürliche Person, welche die Beauftragung zu einem Zweck vornimmt, der überwiegend weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Sie haben in dem Fall das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V., Wenkerstrasse 6a, 40470 Düsseldorf, E-Mail: info@pemphix-shg.de, Telefon: 0162/5206728 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten stehende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
(4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
![]() Widerrufsformular (PDF-Download)
Widerrufsformular (PDF-Download)
Infos – Publikationen / Wissenschaftliche Beiträge
Archiv
Your Subtitle Goes Here

Verein
Vorstand
Your Subtitle Goes Here

Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.
mit Sitz in Düsseldorf
Geschäftsstelle:
Gertrud Bachmann
Wenkerstraße 6a
40470 Düsseldorf
Vertretung:
Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein allein.
1. Vorsitzende: Gertrud Bachmann
2. Vorsitzender: Martin Romberger
Kassenwart: Hanspeter Häberle
Satzung
Your Subtitle Goes Here

Vereinsregistereintrag
Your Subtitle Goes Here

Eintrag ins Vereinsregister:
Registernummer: VR 12591
Registergericht: Düsseldorf
Die “Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.” ist vom Finanzamt Düsseldorf unter der Nummer 105/5886/5060 als gemeinnütziger Verein anerkannt und ist auf Bundesebene erweitert tätig.
Bankverbindung
Your Subtitle Goes Here

Bankverbindung:
Vereinigte VR Bank eG Föhr-Amrum-Kaltenkirchen
IBAN DE24 2179 1906 0000 3532 56
Finanzierung + Förderung
Your Subtitle Goes Here

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern für die ehrenamtliche Mitarbeit und Spenden. Damit wollen wir auch in Zukunft, ohne erhöhten Verwaltungsaufwand, im Interesse unserer Mitglieder tätig sein.
Die Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V. wurde von der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“ im Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 4.500,- Euro, im Jahr 2024 in der Höhe von 6.000,- Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 3.000,- Euro gefördert.
Durch die finanzielle Unterstützung der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene” ist unsere ansonsten von Ehrenamtlichkeit geprägte Arbeit erst möglich. Dafür unseren herzlichen Dank.
Herzlichen Dank an
- die „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene”
- den Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
- den AOK-Bundesverband, eGbR
- den BKK Dachverband e.V.
- den IKK e.V.
- die Knappschaft
- die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.
Die bereitgestellten Mittel werden ausschließlich für gesundheitsbezogene Selbsthilfeaktivitäten in Deutschland verwendet.
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene

Vorstand
Your Subtitle Goes Here

Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.
mit Sitz in Düsseldorf
Geschäftsstelle:
Gertrud Bachmann
Wenkerstraße 6a
40470 Düsseldorf
Vertretung:
Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein allein.
1. Vorsitzende: Gertrud Bachmann
2. Vorsitzender: Martin Romberger
Kassenwart: Hanspeter Häberle
Satzung
Your Subtitle Goes Here

Vereinsregistereintrag
Your Subtitle Goes Here

Eintrag ins Vereinsregister:
Registernummer: VR 12591
Registergericht: Düsseldorf
Die “Pemphigus + Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V.” ist vom Finanzamt Düsseldorf unter der Nummer 105/5886/5060 als gemeinnütziger Verein anerkannt und ist auf Bundesebene erweitert tätig.
Bankverbindung
Your Subtitle Goes Here

Bankverbindung:
Vereinigte VR Bank eG Föhr-Amrum-Kaltenkirchen
IBAN DE24 2179 1906 0000 3532 56
Finanzierung + Förderung
Your Subtitle Goes Here

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern für die ehrenamtliche Mitarbeit und Spenden. Damit wollen wir auch in Zukunft, ohne erhöhten Verwaltungsaufwand, im Interesse unserer Mitglieder tätig sein.
Die Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V. wurde von der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“ im Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 4.500,- Euro, im Jahr 2024 in der Höhe von 6.000,- Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 3.000,- Euro gefördert.
Durch die finanzielle Unterstützung der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene” ist unsere ansonsten von Ehrenamtlichkeit geprägte Arbeit erst möglich. Dafür unseren herzlichen Dank.
Herzlichen Dank an
- die „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene”
- den Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
- den AOK-Bundesverband, eGbR
- den BKK Dachverband e.V.
- den IKK e.V.
- die Knappschaft
- die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.
Die bereitgestellten Mittel werden ausschließlich für gesundheitsbezogene Selbsthilfeaktivitäten in Deutschland verwendet.
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene